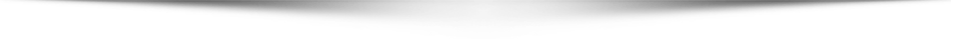Todesängste ausgestanden: Diagnosemitteilung erfolgte nicht nur schonungslos, sondern war auch noch falsch!
 Irren ist menschlich? Ja, doch leider kommen Diagnoseirrtümer im medizinischen Bereich nicht gerade selten vor. Meist geht der Patient dann auch noch leer aus.
Irren ist menschlich? Ja, doch leider kommen Diagnoseirrtümer im medizinischen Bereich nicht gerade selten vor. Meist geht der Patient dann auch noch leer aus.
Anders aber in diesem Fall, der schon am 24.03.2003 vom Oberlandesgericht Bamberg (AZ: 4 U 172/02) entschieden wurde: Ein Patient wurde über viele Wochen im Ungewissen gelassen und hatte Todesängste ausgestanden, weil er glaubte, einen bösartigen Hodentumor zu haben. Schuld daran war ein vom Arzt verwechseltes Gewebestück. Dass in diesem Fall ein Diagnosefehler vorliegt, bedarf wohl kaum der Erläuterung. Aber wann genau spricht man von einem Diagnoseirrtum oder -fehler? Und welche Voraussetzungen müssen vorliegen, damit ein Patient von seinem Arzt aufgrund einer Fehldiagnose Schadensersatz bekommt?
Ein Diagnoseirrtum ist gegeben, wenn der behandelnde Arzt die Befunde, die er entweder selbst erhoben hat oder die ihm aus anderen Quellen vorliegen, falsch interpretiert. Doch nicht jede Fehlinterpretation stellt bereits einen Behandlungsfehler dar. Es muss nämlich auch dem Umstand Rechnung getragen werden, dass Symptome einer Krankheit nicht immer eindeutig sind und gegebenenfalls nicht auf eine bestimmte Erkrankung schließen lassen. Zudem stellt der Behandlungsvertrag zwischen Arzt und Patient rechtlich gesehen einen Dienstvertrag im Sinne des § 611 BGB dar, bei welchem der Arzt nicht einen bestimmten Erfolg (also in diesem Zusammenhang eine zutreffende Diagnose), sondern „nur“ fachgerechtes Handeln schuldet. Man kann also sagen: Irren ist menschlich und kann jedem mal passieren. Nur darf der Arzt dabei eben gewisse Grenzen nicht überschreiten; ihn trifft auf jeden Fall die Pflicht, bei der Befunderhebung und der Stellung der Diagnose eine hohe Sorgfalt walten zu lassen (Facharztstandard).
Doch was bedeutet das nun konkret? Das OLG Bamberg hat zu dem obigen Fall jedenfalls ausgeführt, dass dem Arzt grundsätzlich die Pflicht obliege, den Patienten durch die Art und den Inhalt der Diagnosemitteilung nicht in unnötige Ängste zu versetzen und ihn nicht unnötig zu belasten. Diese Pflicht sei jedenfalls dann verletzt, wenn die eröffnete Diagnose objektiv falsch sei, für sie auch keine hinreichende Grundlage bestehe, sie den Laien auf eine schwere, unter Umständen lebensbedrohende Erkrankung schließen lasse und die Art und Weise der Mitteilung unter den gegebenen Umständen auch geeignet sei, den Patienten in psychischer Hinsicht schwer zu belasten. Dementsprechend verletzt der Arzt seine Pflichten, wenn er untersuchte Gewebestücke verwechselt und dem Patienten daraufhin unter Missachtung des Schonungsgebots mitteilt, es bestehe ein ganz dringender Verdacht des malignen Hodentumors.
Der Patient erhielt in diesem Fall 2.500 € Schmerzensgeld zugesprochen. Nicht gerade viel, aber immerhin ein Zeichen dafür, dass Ärzte nicht in jedem Fall ihren Kopf aus der Schlinge ziehen können.
Deutlich mehr Geld dürfte es hingegen für einen besonders tragischen Fall geben, mit dem sich das Kieler Landgericht zu beschäftigen hatte: Ein Kinderarzt diagnostizierte bei einem damals 2-jährigen Jungen statt einer Hirnhautentzündung lediglich eine Magen-Darm-Grippe. Mit fatalen Folgen: der Junge schwebte zwei Monate lang in Lebensgefahr. Er überlebte glücklicher Weise, musste jedoch eine Amputation seiner Beine und Fingerglieder über sich ergehen lassen. Ob das Gericht der Familie des Jungen tatsächlich wie von ihr gefordert mindestens 1 Million Schadensersatz zuspricht, bleibt allerdings abzuwarten. Bisher liegen in Deutschland die Höchstbeträge für Schmerzensgeld bei etwa 500.000,00 €.